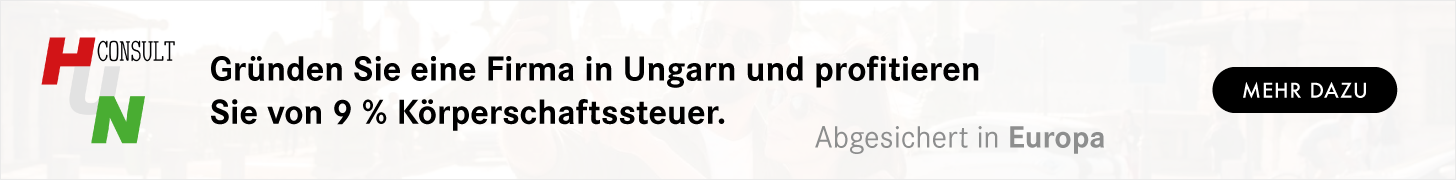Selbstoptimierung beginnt mit der Sprache: Warum ich das Wort „man“ nicht mehr benutze
Von Norbert Peter
Einleitung: Warum Sprache Macht ist
Selbstoptimierung ist mehr als nur eine Trendvokabel – es ist ein ganzheitlicher Prozess, der bei unserer inneren Haltung beginnt. Einer der wichtigsten, aber oft übersehenen Hebel für persönliches Wachstum ist unsere Sprache. Worte formen nicht nur unsere Kommunikation, sondern auch unser Denken.
Ich, Norbert Peter, habe vor einiger Zeit eine bewusste Entscheidung getroffen: Ich verwende das Wort „man“ nicht mehr. Warum? Weil ich erkannt habe, wie sehr uns dieses kleine Wort von unserer eigenen Verantwortung und Individualität entfremdet. In diesem Artikel zeige ich dir, warum bewusste Sprache ein Schlüssel zur Selbstoptimierung ist und wie du durch präzisere Formulierungen klarer, authentischer und selbstbestimmter wirst.
1. Wie das Wort „man“ uns von uns selbst entfernt
1.1 Die Illusion der Allgemeinheit
„Man sollte mehr Sport treiben.“
„Man sagt, dass…“
„Man kann dort gut essen.“
Solche Sätze klingen harmlos, doch sie haben eine tiefgreifende psychologische Wirkung. Indem wir uns hinter dem unpersönlichen „man“ verstecken, vermeiden wir es, Verantwortung für unsere Aussagen zu übernehmen. Wir sprechen nicht mehr aus unserer eigenen Perspektive, sondern verallgemeinern – und verlieren dabei den Bezug zu uns selbst.
Selbstoptimierung bedeutet, bewusst zu leben. Und Bewusstsein beginnt damit, dass wir erkennen, wann wir uns in sprachliche Bequemlichkeit flüchten.
1.2 Warum wir „man“ so häufig benutzen
- Soziale Anpassung: Wir wollen nicht auffallen und übernehmen deshalb gängige Floskeln.
- Verantwortungsvermeidung: „Man“ ist bequem – es lässt Raum für Interpretation und distanziert uns von klaren Aussagen.
- Unbewusste Gewohnheit: Viele Menschen nutzen das Wort, ohne darüber nachzudenken.
Doch wer echte Selbstoptimierung anstrebt, muss solche Muster durchbrechen.
2. Bewusste Sprache in der Kundenberatung: Warum Ganzheitlichkeit entscheidend ist
In meiner Arbeit mit Kunden – sei es im Coaching, in der Unternehmensberatung oder bei Projektentwicklungen – spielt bewusste Sprache eine zentrale Rolle. Denn wer nicht präzise kommuniziert, übersieht leicht essentielle Aspekte, die für den Erfolg entscheidend sind.
2.1 Ganzheitliche Betrachtung als Schlüssel zum Erfolg
Egal, ob ich einen Einzelnen berate, ein Team begleite oder eine Firma strategisch unterstütze: Eine oberflächliche Analyse führt zu oberflächlichen Lösungen. Wer wirklich nachhaltige Ergebnisse erzielen will, muss alle relevanten Faktoren einbeziehen:
- Persönliche Ziele und Werte (bei Einzelpersonen)
- Unternehmenskultur und Marktbedingungen (bei Firmen)
- Ressourcen, Risiken und Stakeholder-Interessen (bei Projekten)
Indem ich in meiner Beratung bewusst auf das Wort „man“ verzichte und stattdessen konkret benenne, wer was tun kann oder sollte, schaffe ich Klarheit. Das vermeidet Missverständnisse und sorgt für eine ganzheitliche Lösungsfindung.
Beispiel aus der Praxis:
Statt: „Man müsste hier die Prozesse optimieren.“
Sage ich: „Ihr Team könnte die Arbeitsabläufe in Bereich X straffen, indem es Y implementiert. Was brauchen Sie dafür?“
2.2 Warum unpräzise Sprache Projekte scheitern lässt
Viele Misserfolge in Unternehmen und Projekten entstehen nicht wegen mangelnder Fachkenntnis, sondern wegen ungenauer Kommunikation. Wenn Verantwortlichkeiten im „Man“ verschwimmen, weiß am Ende niemand, wer was zu tun hat.
Selbstoptimierung im Business bedeutet:
✅ Klare Ich-/Wir-Botschaften statt unverbindlichem „man“
✅ Konkrete Handlungsaufforderungen statt vager Ratschläge
✅ Ganzheitliche Analyse aller Einflussfaktoren
3. Ein persönliches Erlebnis: Wie mich ein Gespräch zum Umdenken brachte
Vor einigen Monaten fragte ich einen Freund: „Was hast du im Urlaub gemacht?“
Seine Antwort: „Man konnte dort schwimmen gehen, man konnte Skifahren, man konnte gut essen.“
Ich unterbrach ihn: „Wer ist ‚man‘? Du? Oder die anderen? Ich habe dich gefragt, nicht die Allgemeinheit.“
Er war überrascht – ihm war nicht bewusst, wie oft er dieses Wort nutzte. Dieses Gespräch war der Moment, in dem ich beschloss, „man“ aus meinem Wortschatz zu streichen.
3.1 Die Macht der direkten Sprache
Statt zu sagen: „Man sollte mehr auf die Gesundheit achten.“
Sage ich: „Ich achte mehr auf meine Gesundheit.“
Der Unterschied? Klarheit, Eigenverantwortung und eine stärkere Verbindung zum eigenen Handeln. Selbstoptimierung funktioniert nur, wenn wir uns selbst klar positionieren.
4. Selbstoptimierung durch bewusste Sprache
4.1 Wie Sprache unser Mindset prägt
Studien aus der Neurolinguistik zeigen: Unsere Wortwahl beeinflusst, wie wir denken und fühlen. Wer ständig „man“ sagt, bleibt im Ungefähren. Wer „ich“ sagt, übernimmt Kontrolle.
Beispiele für mehr Bewusstsein: Unbewusste Sprache Bewusste Sprache „Man müsste mehr lesen.“ „Ich möchte mehr lesen.“ „Man sollte gesünder leben.“ „Ich entscheide mich für eine gesündere Ernährung.“ „Da kann man nichts machen.“ „Ich suche nach einer Lösung.“
4.2 Praktische Übungen zur Sprach-Selbstoptimierung
- „Man“-Detektor: Achte eine Woche lang darauf, wie oft du „man“ sagst. Notiere dir Alternativen.
- Ich-Botschaften: Formuliere Sätze bewusst in der ersten Person.
- Reflexionsfrage: „Stehe ich wirklich hinter dieser Aussage, oder plappere ich nur nach?“
5. Die psychologischen Vorteile, wenn du „man“ ersetzt
5.1 Stärkere Selbstwirksamkeit
Wer „ich“ sagt, signalisiert seinem Unterbewusstsein: „Ich habe die Kontrolle.“ Das stärkt das Selbstvertrauen und fördert proaktives Handeln – ein zentrales Element der Selbstoptimierung.
5.2 Mehr Authentizität
Menschen, die klar und direkt sprechen, wirken überzeugender. Sie strahlen Souveränität aus, weil sie nicht in Allgemeinplätzen verschwimmen.
5.3 Höhere Achtsamkeit im Alltag
Sprache ist wie ein Muskel: Je bewusster wir sie einsetzen, desto stärker wird unsere geistige Präsenz.
6. Warum Unternehmen und Führungskräfte „man“ vermeiden sollten
Auch im Berufsleben ist präzise Sprache ein Erfolgsfaktor. Wer sagt: „Man müsste die Prozesse optimieren.“, wirkt passiv. Wer sagt: „Ich schlage vor, wir optimieren die Prozesse.“, zeigt Initiative.
Selbstoptimierung auf organisationaler Ebene beginnt mit einer Kultur der klaren Kommunikation.
7. Fazit: Selbstoptimierung fängt bei den kleinen Worten an
Indem ich das Wort „man“ aus meinem Sprachgebrauch gestrichen habe, habe ich nicht nur meine Ausdrucksweise verändert – ich habe mein Mindset transformiert. Ich bin klarer, verantwortungsbewusster und bewusster in meinem Denken geworden.
Meine Einladung an dich: Probiere es eine Woche lang aus. Streiche „man“ aus deinem Wortschatz und beobachte, wie sich deine Selbstwahrnehmung verändert.
Selbstoptimierung ist kein Zufall – sie ist eine Entscheidung. Und sie beginnt mit den Worten, die wir täglich benutzen.
Zusammenfassung: Die wichtigsten Schritte zur sprachlichen Selbstoptimierung
✅ Ersetze „man“ durch „ich“ oder „wir“.
✅ Hinterfrage Floskeln: Ist das wirklich deine Meinung?
✅ Nutze Sprache als Werkzeug für mehr Klarheit und Eigenverantwortung.
✅ Analysiere in Beratungen und Projekten alle relevanten Faktoren – nur ganzheitliches Denken führt zu nachhaltigem Erfolg.
Frage an dich: Wann hast du das letzte Mal „man“ gesagt – und was wäre passiert, wenn du stattdessen „ich“ gewählt hättest?**
Bonus: 30-Tage-Challenge für bewusste Sprache
Möchtest du deine Sprachgewohnheiten nachhaltig verändern? Nimm an meiner 30-Tage-Selbstoptimierungs-Challenge teil:
- Tage 1-7: Notiere jedes „man“ in einem Tagebuch.
- Tage 8-14: Formuliere jeden „man“-Satz bewusst um.
- Tage 15-30: Integriere die neue Sprechweise vollständig in deinen Alltag.
Du wirst überrascht sein, wie sehr sich deine Denkweise verändert!
Norbert Peter
P.S.: Wenn dir dieser Artikel gefallen hat, teile ihn mit Menschen, die ihre Sprache bewusster gestalten möchten. Selbstoptimierung ist ein Teamspiel – je mehr Menschen mitmachen, desto stärker wird die Wirkung!